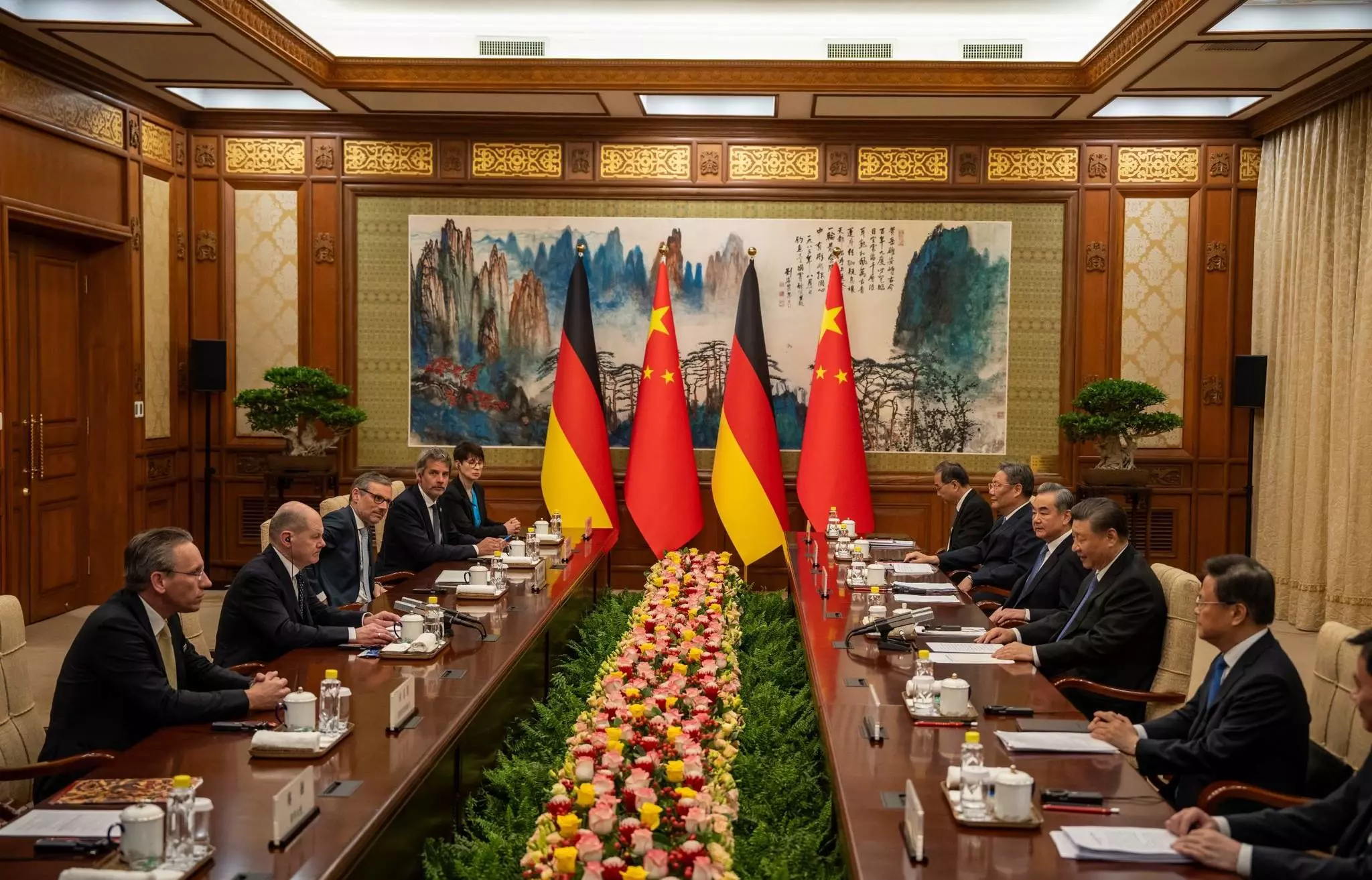In kommender Woche steht Bundestag vor seiner ersten großen Bewährungsprobe, bei der Koalition aus CDU/CSU, SPD und Grünen keine Zweidrittelmehrheit hat.
Ohne diese Mehrheit können weder Änderungen des Grundgesetzes verabschiedet noch Richter des Verfassungsgerichts ernannt werden. Damit sind die Abgeordneten befasst. Laut Grundgesetz beträgt die Amtszeit der Richter zwölf Jahre, eine Wiederwahl ist nicht möglich. Die Altersgrenze liegt bei 68 Jahren, ab der ein Richter in den Ruhestand treten muss. In der kommenden Woche soll der Bundestag drei der 16 Richter neu wählen, da einer der amtierenden Richter sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niederlegt.
Die Ernennung der Richter folgt einem recht komplizierten Schema, das – und das ist das Wichtigste – 2018 in einer anderen politischen Realität vereinbart wurde. Je sechs Richter werden von CDU/CSU und SPD nominiert, je zwei von den Grünen und der FDP. Weder die Linke noch die AfD wurden in diese Formel einbezogen, da ihre Stimmen für eine Zweidrittelmehrheit damals nicht benötigt wurden. Jetzt aber schon.
Den Medien zufolge hat die Linke keine substantiellen Einwände gegen den wahrscheinlichen Kandidaten der CDU/CSU sowie die beiden voraussichtlichen Kandidaten der SPD. Eine der SPD-Kandidatinnen wird von einigen Christdemokraten infrage gestellt, unter anderem, weil sie sich während der Coronavirus-Pandemie für eine Impfpflicht ausgesprochen hat. Die Linke stellt die Nominierungsformel infrage, da sie ihre Vorschläge frühestens im Jahr 2033 vorlegen kann.

Die Parteiführer sind der Ansicht, dass dieser Mechanismus anachronistisch ist und gegen demokratische Grundsätze verstößt. Ihre Ziele gehen jedoch noch weiter: Sie erklären ausdrücklich, dass die CDU/CSU unter den neuen Bedingungen den Unvereinbarkeitsbeschluss und das Prinzip der Nichtzusammenarbeit – eine Brandmauer gegen die Linke – aufgeben muss.
Bislang hat sich die Partei von Friedrich Merz strikt daran gehalten. Gerade um nicht mit der Linken zu verhandeln, hat der letzte Bundestag, als der neue Bundestag schon gewählt war, in einer Dringlichkeitssitzung genau dieses Finanzpaket verabschiedet. Letzte Woche wurde zudem Heidi Reichinneck, die populäre Co-Vorsitzende der Linksfraktion, nicht in das parlamentarische Kontrollgremium gelassen, das die Tätigkeit der Geheimdienste überwacht. All das sorgt bei den Linken für vorhersehbare Empörung: Nach dem gescheiterten ersten Wahlgang der Kanzlerwahl haben sie mit ihren Stimmen einen zweiten Wahlgang am gleichen Tag ermöglicht.
Das Kalkül der CDU/CSU scheint nun zu sein, dass die Linke letztlich ohne Verhandlungen für ihren Kandidaten stimmen wird, da die Richter des Verfassungsgerichts ihn Ende Mai einstimmig bestätigt haben. Selbst wenn die Bundestagsabgeordneten jetzt keine neuen Richter wählen können, geht das Wahlrecht gemäß der im letzten Jahr eigens für einen solchen Fall beschlossenen Grundgesetzänderung an den Bundesrat. Und dort kann eine Zweidrittelmehrheit ohne die Linke erreicht werden.
Doch hier kommt das Risiko namens AfD ins Spiel. Denn mit ihren Stimmen können zwei Drittel im aktuellen Bundestag erreicht werden. Das ist eine Situation, die die Regierungskoalition um jeden Preis vermeiden möchte.

So oder so wird man sich mit der Linken einigen müssen. Der Koalitionsvertrag enthält das Versprechen, die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse bis Ende 2025 zu reformieren. Ohne eine Zweidrittelmehrheit des Bundestages wird eine Verfassungsänderung jedoch nicht möglich sein. Man könnte sich natürlich einen Dreck um den Koalitionsvertrag scheren. Das scheint bei der versprochenen Strompreissenkung bereits der Fall zu sein, denn ohne russisches Gas ist diese stark gefährdet. Für die Koalition – vor allem für den sozialdemokratischen Teil – könnte dies jedoch ein unerträglicher Schlag sein.